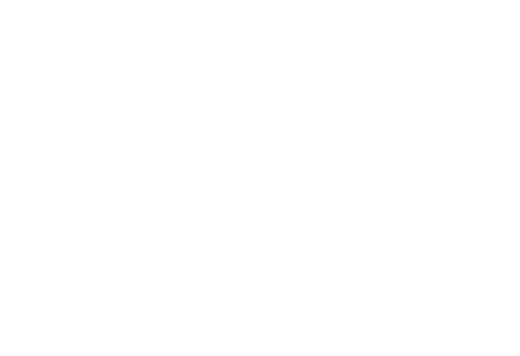Das über 50 Seiten starke Gutachten zur "Weiterentwicklung der Lehrkräftebildung in Bayern" wurde von einer unabhängigen Kommission erstellt. Ziel war es, die Qualität, Passgenauigkeit und Zukunftsfähigkeit der Lehrkräftebildung zu stärken – insbesondere angesichts von Lehrkräftemangel, gesellschaftlichem Wandel und allgemein gestiegenen Anforderungen an Schule.
Die fünf Kerngedanken des Gutachtens
1. Professionsbezug & Wissenschaftsorientierung
Das Studium soll klar auf den Beruf vorbereiten – und gleichzeitig forschungsbasiert bleiben. Theorie und Praxis dürfen nicht länger nebeneinander herlaufen.
“Ein zu geringer Berufsfeldbezug und eine unzureichende Verknüpfung von Theorie und Praxis zählen zu den […] häufigsten angeführten Kritikpunkten am Lehramtsstudium.” (S. 13)
2. Inklusion & Heterogenität
Der inklusive Umgang mit Vielfalt wird zur Kernkompetenz aller Lehrkräfte – unabhängig von Schulart oder Fach. Dafür braucht es klare Kompetenzziele und verbindliche Inhalte.
“Der Umgang mit der zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft […] muss darauf zielen, für alle Kinder und Jugendlichen passende Lern- und Entwicklungsangebote zu gestalten. Deshalb ist ein inklusiver Umgang mit Heterogenität eine Kernkompetenz jeder Lehrkraft.” (S. 16)
3. Core Practices
Die Ausbildung soll sich stärker an sog. Core Practices orientieren – also grundlegenden professionellen Handlungen wie z. B. Erklären, Feedback geben, Diagnostizieren. Diese werden fachlich und fachdidaktisch differenziert gelehrt und geübt. Auch müssen Lehramtsstudiengänge laut Gutachten dringend auf die Herausforderungen der digitalen Welt reagieren. Medienpädagogik, Datenschutz, KI-Nutzung und digitale Didaktik sollen verbindlich verankert werden.
“Der innovative Ansatz der Core Practices stärkt die Professionsorientierung der Lehrkräftebildung, ermöglicht den Transfer wissenschaftlicher Theorie in Praxisanteile des Lehramtsstudiums und schafft Kohärenz zwischen bestimmten Bereichen und Phasen in der Lehrkräftebildung.” (S. 20)
4. Praktika
Die Praxisphasen im Studium sollen verlängert und besser mit der Theorie verzahnt werden. Denkbar wäre etwa ein Praxissemester nach dem Vorbild anderer Bundesländer. Mehr Praktika alleine bringen nichts. Stattdessen sollen Praxisanteile besser begleitet, theoriebasiert reflektiert und curricular verzahnt werden. Ziel: echter Kompetenzaufbau statt Praxisschock. Daneben empfiehlt die Kommission einen Verzicht auf das Betriebspraktikum sowie eine Veränderung des Orientierungspraktikums.
“[F]ür den Erwerb professioneller Kompetenzen bei Lehramtsstudierenden [geht es] nicht um ein Mehr an Praktika, [sondern die] […] Praxisanteile erfordern eine didaktische Einbettung und Begleitung, damit sie ihre Wirkung entfalten können. Praktika werden dazu beitragen, Situationen aus dem Berufsalltag unter Anwendung wissenschaftlicher Befunde kritisch zu reflektieren, auf Handlungsalternativen hin zu untersuchen und da und das Repertoire an Handlungsmöglichkeiten in komplexen Situationen zu erweitern." (S. 24f.)
5. Staatsexamen
Die Kommission schlägt vor, alle Lehramtsstudiengänge auf zehn Semester und 300 ECTS umzustellen. Das Staatsexamen soll erhalten bleiben, aber reformiert werden.
“[I] m ersten Staatsexamen [wird] überwiegend Wissen, aber kaum Kompetenzen getestet […] und die Prüfungsanforderungen [stehen] oft wenig mit den Handlungsanforderungen des Lehrberufs im Zusammenhang […]. Da hier häufig Wissensinhalte der unterschiedlichen Fächer ohne umfassenden Professionsbezug geprüft werden, eignet sich das Staatsexamen in der derzeitigen Form wenig.”
“[E]ine Weiterentwicklung der ersten Staatsprüfung hin zu einer stärkeren Ausrichtung an den im Lehrberuf erforderlichen Kompetenzen [wird] […] empfohlen. Dies erfordert einerseits eine Weiterentwicklung von Prüfungsinhalten[,] [a]ndererseits wird die verstärkte Entwicklung, Erprobung und Nutzung kompetenzorientierter Prüfungsformate empfohlen, die an authentischen Praxisproblemen ansetzen und auch digitale Möglichkeiten nutzen.” (S. 36f.)
Warum ist das für uns als Studierende wichtig?
Auch wenn es sich “nur” um Empfehlungen handelt – das Gutachten dürfte politischen Einfluss haben. Vorteile für uns als Studierende sind:
- Mehr Flexibilität und Durchlässigkeit: Wechsel zwischen Schularten oder Fächern könnten einfacher werden
- Mehr Relevanz und Praxisnähe im Studium: Inhalte sollen sich stärker an realen Anforderungen im Klassenzimmer orientieren
Kritikpunkte aus Sicht der Studierenden:
Natürlich wirft das Papier auch Fragen auf. Wie soll die Umstellung konkret aussehen? Werden bestehende Studiengänge angepasst oder ganz neu aufgestellt? Und was passiert mit Studierenden, die mitten im aktuellen System sind?
Für die Studierenden im BLLV ist klar: Reformen müssen mit uns und nicht über unsere Köpfe hinweg gestaltet werden. Gute Lehrkräftebildung braucht Beteiligung, Verlässlichkeit und Klarheit.
Simon Kratzer, 2. Vorsitzender der Studierenden im BLLV, studiert in Augsburg Mittelschullehramt mit dem Unterrichtsfach Geschichte und den Didaktikfächern Deutsch, Sport sowie Politik und Gesellschaft