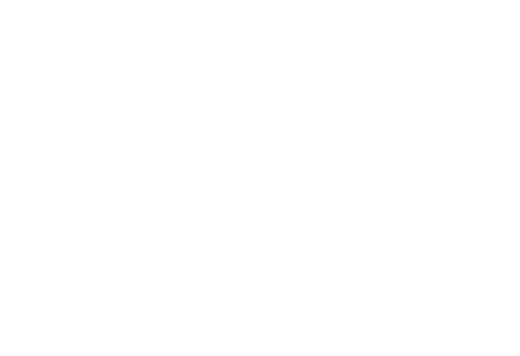Wenn eine Bildungsministerin darüber nachdenkt, wie viele Kinder mit Migrationshintergrund „vertretbar“ in einer Schulklasse sind, ist etwas gewaltig aus dem Gleichgewicht geraten. Denn was hier als Problem erscheint, ist in Wahrheit Ausdruck einer gesellschaftlichen Normalität: Wir leben in einer postmigrantischen Gesellschaft und unsere Schulen sind ihr lebendiges Abbild. Wer in dieser Realität versucht, künstliche Grenzen bei der Zusammensetzung von Schulklassen zu ziehen, versucht nicht zu integrieren, sondern zu sortieren, entlang von Herkunft, vermeintlicher Zugehörigkeit und letztlich entlang einer ausgrenzenden Ideologie von Homogenität.
Der Begriff „postmigrantisch“ steht für genau diesen notwendigen Perspektivwechsel: Migration ist nicht mehr das „Andere“, das irgendwann überwunden werden müsste. Die deutsche Politik- und Sozialwissenschaftlerin und Leiterin des Deutschen Zentrums für empirische Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) Naika Foroutan betont, dass in postmigrantischen Gesellschaften nicht mehr Herkunft oder Abstammung im Vordergrund stehen, sondern die gemeinsamen Aushandlungsprozesse nach der Migration: Wie wollen wir zusammen leben? Was macht Zugehörigkeit aus? Die starre Unterscheidung zwischen „den Deutschen“ und „den Migrant*innen“ ist faktisch wie normativ nicht mehr haltbar und auch in der Schule längst überholt. Dennoch hält sich in unserer Gesellschaft diese Idee hartnäckig.
Dass Sprache entscheidend für Bildungserfolg ist, stellt niemand infrage. Aber die richtige Frage ist nicht: Wie viele Kinder mit Migrationshintergrund dürfen in einer Klasse sein? Sondern: Wie fördern wir Kinder so, dass sie bestmöglich lernen können?
Eine „Migrant*innenquote“ suggeriert, dass zu viel Vielfalt ein Nachteil sei. Dabei zeigen zahlreiche Studien und die pädagogische Praxis, dass gerade heterogene Lerngruppen soziale Kompetenzen, Perspektivenvielfalt und Empathie fördern. Schulen, in denen Mehrsprachigkeit, verschiedene kulturelle Erfahrungen und hybride Identitäten präsent sind, bieten enorme Chancen für ein demokratisches Zusammenleben.
Eine Schule, die sich als Raum für Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit versteht, darf die Realität einer postmigrantischen Gesellschaft nicht ignorieren oder begrenzen. Dazu gehört natürlich der Ausbau früher und nachhaltiger Sprachförderung. Aber genauso wichtig ist der richtige Umgang mit problematisierenden Kategorien, wie „Migrationshintergrund“, die in erster Linie ausgrenzen. Schule braucht keine Quoten. Schule braucht Ressourcen, gut ausgebildetes Personal, rassismuskritische Perspektiven und politische Klarheit. Schule kann ein Ort sein, an dem Gemeinschaft herrscht. Aber nicht, wenn wir weiter versuchen, in „wir“ und „die anderen“ zu unterteilen.
Quelle: Foroutan, Naika. Die postmigrantische Gesellschaft: Ein Versprechen der pluralen Demokratie. Bielefeld: transcript Verlag, 2019.
Mustafa Cakmak, Beisitzender der Studierenden im BLLV, studiert in München Gymnasiallehramt mit der Fächerkombination Englisch und Geschichte
Weiterführende Links: Obergrenzen-Gerede gefährdet pädagogische Integrationsarbeit - BLLV-Artikel